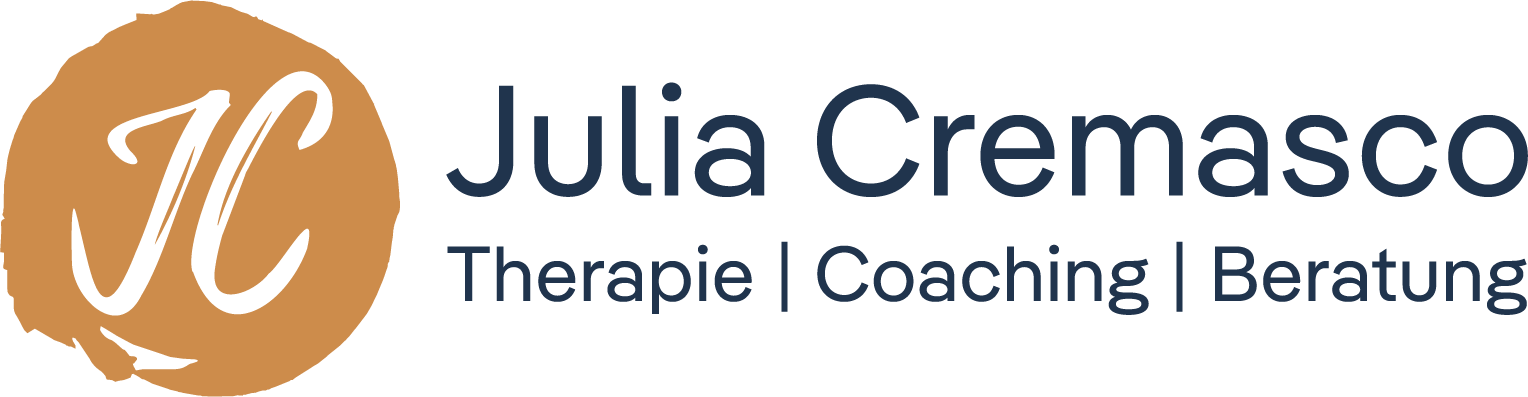Funktionieren bis zum Zusammenbruch – ein Systemfehler, kein Einzelschicksal
Perfektionismus – wenn der Anspruch, alles richtig zu machen, zur Belastung wird
Perfektionismus klingt für viele zunächst nach einem hohen Qualitätsanspruch – doch für unzählige Frauen ist er weit mehr als das. Er ist ein innerer Druck, der nie nachlässt. Ein ständiges Gefühl, noch nicht genug getan zu haben. Besonders in einem Alltag voller Anforderungen – im Job, in der Familie, im sozialen Umfeld – führt Perfektionismus nicht selten zu chronischer Erschöpfung, emotionaler Taubheit und dem Verlust der eigenen Mitte. Darum geht es in diesem Artikel.
Wenn Leistung alles bedeutet – und das Selbst auf der Strecke bleibt
In unserer Gesellschaft gilt sie als Inbegriff von Stärke: die Frau, die alles meistert. Beruf, Familie, Partnerschaft, Selbstfürsorge – am besten gleichzeitig und mit einem Lächeln. Sie organisiert, plant, denkt mit, denkt voraus. Sie ist verlässlich, verantwortungsbewusst, präsent. Und doch – viele dieser scheinbar starken Frauen tragen eine tiefe, kaum sichtbare Erschöpfung in sich. Eine Müdigkeit, die nicht durch Schlaf verschwindet. Ein inneres Leeregefühl, das sich kaum in Worte fassen lässt.
Was sie oft gemeinsam haben: ein unerschütterlicher innerer Antreiber. Und ein Muster, das sie seit frühester Kindheit begleitet: Ich bin nur dann etwas wert, wenn ich leiste.
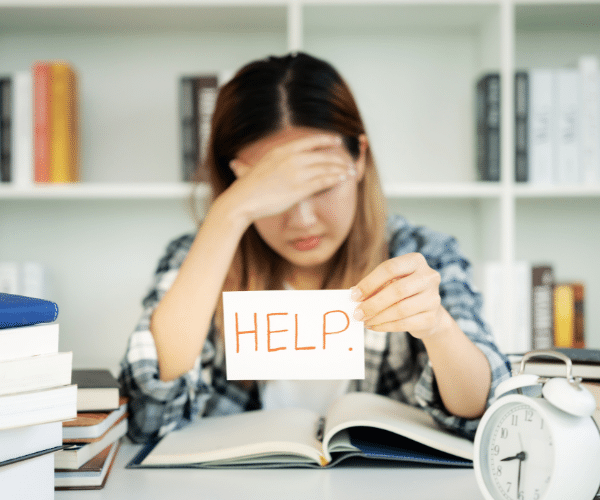
Frühe Prägungen: Wenn Anerkennung nicht bedingungslos war
Für viele beginnt dieses Muster schon in der Kindheit. In Familien, in denen Zuwendung vor allem dann gegeben wurde, wenn man „brav“ war. Oder wenn gute Leistungen erbracht wurden. Oder wenn man sich besonders angepasst verhielt. Die Botschaft, die sich leise und tief verankert, lautet:
Sei nützlich, stark und unproblematisch. Dann wirst du gesehen und geliebt.
Das Resultat ist oft ein Leben im Funktionsmodus. Gefühle werden nachrangig, Bedürfnisse unterdrückt. Stattdessen wird weitergemacht – auch wenn es weh tut, auch wenn die Grenzen längst überschritten sind.
Perfektionismus als Selbstschutz – und als Belastung
Viele Frauen, die sich heute in dieser Rolle wiederfinden, würden sich selbst nie als perfektionistisch beschreiben. Sie sagen eher: “Ich mache es halt ordentlich.” Oder: “Ich möchte es einfach gut machen.” Doch hinter dieser scheinbaren Bescheidenheit verbirgt sich oft ein tiefer Anspruch an sich selbst: keine Fehler machen, keine Schwäche zeigen, niemanden enttäuschen.
Perfektionismus ist in diesem Kontext kein Schönheitsideal oder Ordnungsfimmel – sondern ein psychologischer Schutzmechanismus. Er gibt
- Halt, wo Vertrauen fehlt.
- Kontrolle, wo Unsicherheit dominiert.
- Anerkennung, wo früher vielleicht Mangel herrschte.
Aber er fordert seinen Preis.
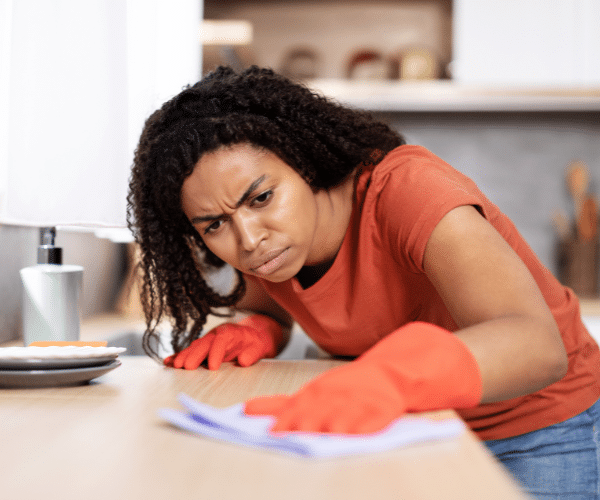
Symptome, die nicht nach außen dringen
Das chronische Überfunktionieren bleibt selten ohne Folgen. Die Belastung zeigt sich auf unterschiedlichen Ebenen:
- Emotional: Reizbarkeit, Stimmungsschwankungen, das Gefühl der inneren Leere oder der Überforderung
- Körperlich: Schlafstörungen, Verspannungen, Magen-Darm-Probleme, chronische Erschöpfung
- Psychisch: diffuse Ängste, depressive Phasen, ein ständiger innerer Druck, nie genug zu sein
- Sozial: Rückzug, Konflikte in Partnerschaft oder Freundschaften, Schwierigkeiten mit Nähe
Viele der betroffenen Frauen suchen erst dann Hilfe, wenn es gar nicht mehr anders geht – wenn sie körperlich oder seelisch zusammenbrechen. Der Gedanke, sich Hilfe zu holen, kommt ihnen oft erst, wenn sie selbst nicht mehr funktionieren.
Die gesellschaftliche Dimension: Zwischen Fortschritt und Überforderung
Zweifellos hat sich in den letzten Jahrzehnten viel verändert. Frauen sind heute präsenter in Führungspositionen, finanziell unabhängiger, besser ausgebildet als je zuvor. Und trotzdem ist es so, dass mit der Emanzipation nicht automatisch eine Entlastung kam. Im Gegenteil: Viele erleben eine neue Form der Überforderung. Sie sollen erfolgreich im Beruf sein, liebevoll als Mutter, attraktiv als Partnerin, ausgeglichen, gesund, bewusst lebend – und das alles gleichzeitig.
Gerade in Verbindung mit einem inneren Anspruch, immer alles richtig machen zu wollen, entsteht so ein kaum auszuhaltender Druck. Eine Art unsichtbarer Mehrfachbelastung, die nach außen selten sichtbar ist – aber im Inneren schleichend aufzehrt.

Was sich verändern muss – individuell und gesellschaftlich
Ein erster Schritt ist das Erkennen. Das Wahrnehmen der eigenen Grenzen. Und vor allem: das Erlauben, nicht perfekt sein zu müssen. Viele Frauen brauchen nicht den nächsten Tipp zur besseren Organisation oder eine neue App, die sie noch effizienter macht. Sie brauchen etwas ganz anderes: Raum. Verständnis. Echtheit. Und die Erlaubnis, sich selbst wieder näher zu kommen.
Therapie kann hier ein wichtiger Wegbegleiter sein. Nicht, um „zu reparieren“. Sondern um zu erkennen: Du darfst Grenzen haben. Du darfst
- innehalten.
- Nein sagen.
Und du musst nichts beweisen.
Aber auch gesellschaftlich braucht es ein Umdenken. Wir müssen aufhören, Menschen dafür zu bewundern, dass sie sich selbst aufopfern. Stattdessen brauchen wir Vorbilder, die ehrlich mit ihren Grenzen umgehen. Die zeigen, dass wahre Stärke nicht im Funktionieren liegt – sondern im Fühlen. Und im Mut, etwas zu verändern.
Es darf leichter werden – ein erster Schritt zurück zu dir
Wenn du dich in diesen Zeilen wiedererkennst, bist du nicht allein. Vielleicht spürst du schon länger, dass etwas nicht mehr passt und du müde bist vom Funktionieren. Vielleicht hast du schon bemerkt, dass da irgendwo in dir der Wunsch wächst, dich selbst wiederzufinden – jenseits von To-do-Listen, Ansprüchen und Perfektionsdruck.
Ich lade dich ein zu einem geschützten Raum, in dem du wieder atmen darfst.
Ein Erstgespräch kann der Anfang sein. Nicht als Verpflichtung, sondern als Angebot. Um zuzuhören. Um gemeinsam zu schauen. Und um herauszufinden, was du wirklich brauchst – nicht nur als Frau, sondern als Mensch.
Was ist mit „hochfunktionalen Frauen“ gemeint?
Der Begriff beschreibt Frauen, die im Alltag außergewöhnlich leistungsfähig und organisiert wirken, innerlich jedoch oft mit starkem Druck, Perfektionismus und Erschöpfung kämpfen. Ihre Herausforderungen bleiben häufig unbemerkt, weil sie nach außen „funktionieren“.
Wie erkenne ich, ob mein Perfektionismus problematisch ist?
Wenn du das Gefühl hast, nie genug zu leisten – egal wie sehr du dich anstrengst – oder wenn du dich oft erschöpft, leer oder überfordert fühlst, kann das ein Hinweis darauf sein, dass dein Perfektionismus dich belastet. Auch körperliche Symptome wie Schlafstörungen oder Verspannungen sind ernst zu nehmen.
Ist es normal, sich manchmal emotional leer oder innerlich abgekoppelt zu fühlen?
Ja – viele Menschen erleben Phasen emotionaler Erschöpfung. Doch wenn dieses Gefühl über längere Zeit anhält oder deine Lebensqualität einschränkt, kann es sinnvoll sein, professionelle Unterstützung in Anspruch zu nehmen.
Hilft ein Coaching oder braucht es eine Psychotherapie?
Das hängt davon ab, wie tief die Belastung geht. Coaching kann Impulse geben, wenn du funktional bist, aber Orientierung suchst. Eine Therapie ist empfehlenswert, wenn du unter anhaltendem Leidensdruck stehst, z. B. durch depressive Verstimmungen, Ängste oder psychosomatische Beschwerden.
Wie kann ich lernen, mit meinem Perfektionismus umzugehen?
Ein erster Schritt ist, ihn überhaupt als Teil deiner inneren Muster zu erkennen – ohne Schuld oder Scham. In einem geschützten therapeutischen Raum kannst du lernen, alte Glaubenssätze zu hinterfragen und neue Wege zu finden, mit dir selbst freundlicher und realistischer umzugehen.
Wenn dir dieser Beitrag gefallen hat, hast du vielleicht Lust hier weiterzulesen: