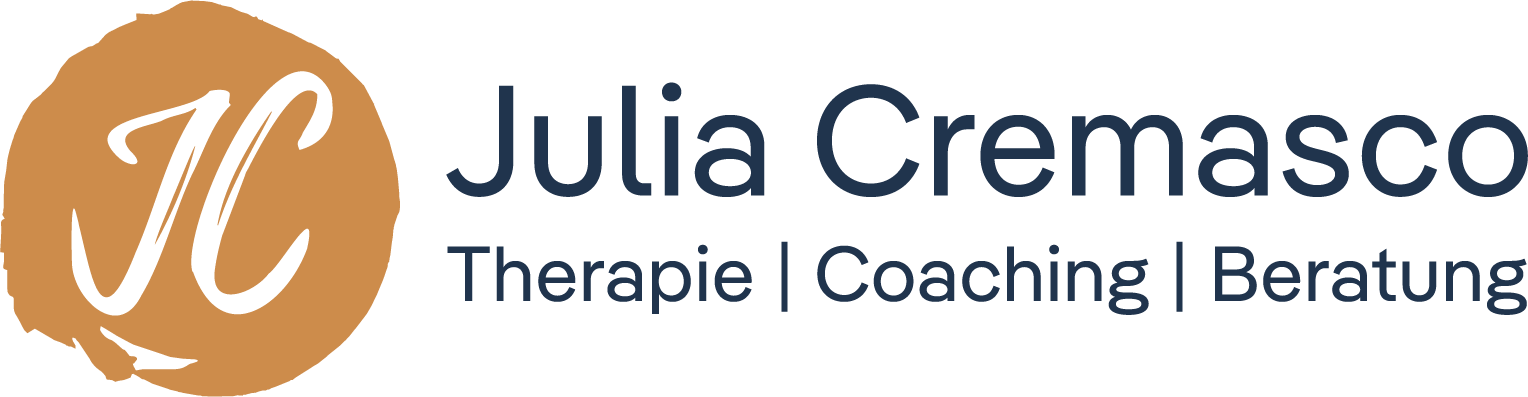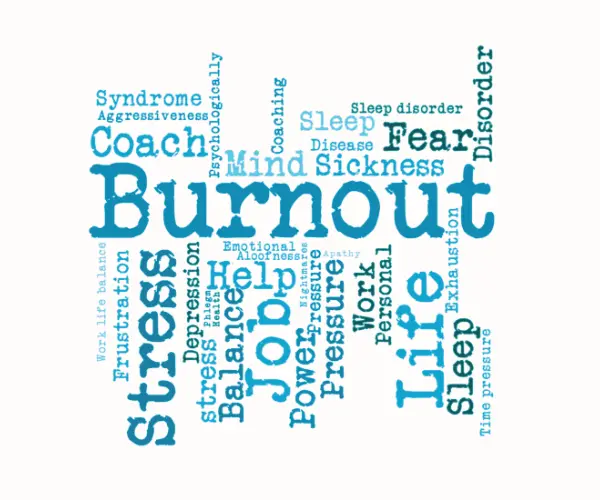Burnout – steckst auch du vielleicht mitten drin?
In diesem Artikel beantworte ich häufig gestellte Fragen zum Burnout. Denn nicht wenige Menschen fürchten sich vor dieser fiesen Form der völligen Erschöpfung und dem damit einher gehenden kompletten Zusammenbruch. Ich will dir mit dem Beitrag helfen, deine möglicherweise vorhandene Verunsicherung zu beseitigen. Fehlt eine Antwort auf eine für dich wichtige Frage, melde dich bitte.
Was ist ein Burnout?
Ein Burnout ist ein extrem starker Erschöpfungszustand, der hervorgerufen wird durch langanhaltende Belastungen. Das kann eine ständige Überlastung im Job sein, aber auch eine private Belastung wie die Pflege eines kranken Familienmitgliedes oder eine Überforderung durch permanente Mehrfachbelastung (Job + Haushalt + Kindererziehung). Im schlimmsten Fall geht die psychische Erschöpfung einher mit einem körperlichen Zusammenbruch, sodass ein Klinikaufenthalt notwendig ist.
Beim Burnout sprechen die Fachleute von einem sogenannten Syndrom. Das bedeutet, dass mehrere zeitgleich auftretende Symptome typisch sind für diesen Zustand.
Wie merke ich, dass ich einen Burnout habe? Was sind die typischen Symptome?
Wenn du
- dich dauernd müde, erschöpft und überfordert fühlst (psychisch und körperlich),
- feststellst, dass du nicht mehr leistungsfähig bist und es sogar zu viel ist, den Müll zur Mülltonne zu bringen,
- antriebslos, kraftlos und interessenlos bist,
- schnell aus der Haut fährst und aggressiv wirst,
- diese körperlichen Symptome immer wieder erlebst: Schwindel, Kopfschmerzen, Schlafprobleme, Kieferschmerzen (wegen des nächtlichen Zähneknirschens), Atembeschwerden, Muskelschmerzen (zB im Rücken), Verdauungsstörungen,
- merkst, dass dein Selbstwertgefühl schwindet,
- dich nicht mehr richtig erholen kannst,
dann solltest du dir Hilfe suchen. Denn es kann sein, dass es sich um die Symptome eines Burnouts handelt.
Beachte bitte: Ein kurzer Text im Internet ist keine individuelle Diagnose. Bitte hol dir einen Termin bei einer Therapeutin oder einem Therapeuten, wenn du Klarheit haben willst.
Wie verläuft ein Burnout?
Ein Burnout verläuft in Phasen über einen längeren Zeitraum, der Endzustand wird als Burnout bezeichnet:
Grob gesprochen ergeben sich eine
- Alarmphase
- Widerstandsphase
- Erschöpfungsphase
Die drei Phasen untergliedern sich in insgesamt zwölf klassische Einzelphasen. Herbert Freudenberger und Sigmund Ginsburg waren Namensgeber des Burnouts und in den 1970er Jahren Entwickler dieses Phasenmodells. Dieses Modell findest du im Internet oft als Kreis dargestellt. Ich finde dies etwas irreführend, da es sich nicht um einen Kreislauf, sondern um einen Ablaufprozess handelt mit dem Endpunkt Burnout.

Was tun bei einem Burnout?
Wenn du dich erschöpft, kraftlos und ausgebrannt fühlst, dann ist es wirklich sehr wichtig gegenzusteuern.
Es existieren diverse Ansätze – von ambulant bis stationär.
Nach meiner Erfahrung ist es sinnvoll, in einem zweistufigen Verfahren zu arbeiten:
- Im ersten Schritt sollte es darum gehen, dass du verstehst, wie essentiell notwendig das Auftanken ist, und dass du eben selbiges intensiv tust: Auftanken.
- Im zweiten Schritt, wenn wieder Kraft vorhanden ist, gilt es, die machtvollen Gewohnheiten zu bearbeiten, die dazu geführt haben, dass du ausgebrannt bist.
Dieser zweite Schritt ist wirklich sehr wichtig. Ich habe in meiner Arbeit nicht nur einmal Menschen erlebt, die mehrfach in einen Burnout geschliddert sind – weil die alten Gewohnheiten über Jahre hinweg immer wieder Oberhand gewonnen haben.
Sehr oft spielen innere Kritiker eine große Rolle bei der Entwicklung eines Burnouts. Dabei handelt es sich um Gewohnheiten, die teilweise bereits in der Kindheit entstanden sind. „Du musst…“ oder „Du darfst nicht…“ sind ganz typische Befehle, die ein innerer Kritiker dir ständig einflüstert. Diese führen zu bestimmten, gewohnheitsmäßigen Verhaltensweisen, welche es mit Blick auf den Burnout zu verändern gilt. Wenn du grundsätzlich deine inneren Kritiker in den Griff bekommen willst, schau dir gern mal mein Programm an „Wie ich meinem inneren Kritiker auf die Schliche komme und meinen Stress-Typen entlarve“
Warum gilt der Burnout nicht als Krankheit?
Seit 2022 existiert das ICD in seiner elften Version (ICD 11). Dies ist ein großer Katalog mit allen Krankheiten (Offizieller Titel: Internationale statistische Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme), entwickelt von der Weltgesundheitsorganistation WHO.
Und in der elften Version wird Burnout erstmals als Krankheit aufgeführt – ja, das ist gut so! Früher haben Menschen, die in einen Burnout gerutscht sind, die Diagnose „Depression“ oder manchmal auch „Neurasthenie“ erhalten. Das waren quasi Verzweiflungsdiagnosen, denn für das Phänomen Burnout existierte keine passende. Dann kann die Zusatzdiagnose für Burnout dazu. Nur leider brauchte man immer noch eine Hauptdiagnose, damit die Zusatzdiagnose gestellt werden konnte. Also bekamen die Erschöpften den Stempel „Depression“.
Und das war in den meisten Fällen sehr unpassend. Denn wenn man einen Menschen mit Depression erlebt und daneben einen mit Burnout, dann sind das in der Regel himmelweite Unterschiede. Eine Person mit Burnout ist meistens emotional komplett anders davor: Die Betroffenen sind sehr oft emotional schwingungsfähig, häufig ist ein hohes Leistungsstreben spürbar und „ein Wollen“. Dieses wird jedoch von einem massiven Erschöpfungsgefühl gestoppt. Menschen, die in einen Burnout rutschen, sind meist zuvor „1000 Volt-Personen“ gewesen.
Eine Person mit Depression dagegen ist in der Regel gar nicht mehr so recht in der Lage etwas zu fühlen bzw. es fühlt sich alles gleich grau an. Diese Person spürt meist keinen Antrieb für irgendwas.
Und natürlich sind die Übergänge fließend.
Gibt es Mängel in der Burnout-Forschung?
Der bereits genannte Freundenberger hat damals den Burnout ausschließlich als Phänomen der Berufswelt gesehen. Mittlerweile ist offensichtlich, dass Menschen auch aufgrund von Care-Arbeit erschöpfen können.
Burnout ist ein Syndrom, das unterschiedliche Lebensaspekte gleichzeitig berührt – medizinische, soziologische und wirtschaftliche Aspekte, möglicherweise auch philosophische Aspekte etc. Ich finde es wichtig, dass die Forschung sich der ganzheitlichen, fachgebietsübergreifenden und auch grenzüberschreitenden Arbeit immer mehr öffnet. Burnout ist ein weltweites, gesellschaftliches Problem der Industrieländer.
Die Zahl der Krankschreibungen wegen psychischer Probleme verzeichnet seit Jahren einen steigenden Trend. Kraftlosigkeit, Erschöpfung, Burnout sind nach meinem Dafürhalten das Ergebnis des permanenten Optimierungs- und Steigerungstrends. Ich bin mittlerweile eine große Verfechterin für ein grundlegendes Überdenken der Werte in der Wirtschaft. Ist diese Rigorosität tatsächlich angebracht? In Anbetracht knapper Ressourcen (Menschen, Bodenschätze, fossile Brennstoffe) definitiv.
Was aber im Hinblick auf die Burnout-Forschung wichtig ist, ist die Tatsache, dass das Entstehen eines Burnouts immer multifaktoriell ist. Die Forschung sollte deshalb unbedingt breit aufgestellt bleiben.
Sind die Menschen heute tatsächlich höheren Belastungen ausgesetzt als früher?
Aus meiner Sicht sind die Belastungen nicht höher – sondern anders. Und dieses „Andere“ hat das Entstehen von Burnout vorangetrieben. Schauen wir auf die Bevölkerung in den 1950er und 1960er Jahren, dann erhalten wir das Bild einer stark körperlich arbeitenden Bevölkerung.
Europa und Deutschland war vom Wiederaufbau geprägt nach dem Zweiten Weltkrieg, viele Annehmlichkeiten, die heute selbstverständlich sind, gab es zu der Zeit noch nicht. Die Arbeitstage waren lang und ausgefüllt, Samstagsarbeit war eher Standard als Ausnahme. Auch im Haushalt gab es vieles, was von Hand zu erledigen war. Zeitdruck, wie wir ihn heute kennen, spielte aber nur eine untergeordnete Rolle.
Auch der Werdegang eines Menschen war in dieser Zeit in der Regel recht früh vorgezeichnet, es kam selten vor, dass ein Kind aus einfachen Verhältnissen die Schulbildung genießen konnte, die es ihm ermöglichte, einen akademischen Werdegang einzuschlagen. Man blieb quasi seinem Stand treu. Die Strukturen waren übersichtlich und sehr klar. Das Internet existierte nicht. Ein Feierabend bedeutete wirklich Abstand von der Arbeit.
Die große Freiheit
Heute dagegen genießen wir eine sehr viel größere Freiheit in vielen Lebensbereichen. Uns stehen in der Ausbildung äußerst viele Türen offen, auch Kinder aus benachteiligten Familien haben grundsätzlich die Möglichkeit zur Hochschule gehen. Freiheit ist toll und gleichzeitig kann sie überfordern. Diese immense Freiheit in Verbindung mit der stetigen steigenden Informationsflut und permanenten Erreichbarkeit durch Email und Mobilfunk wirkt belastend. Klarheit ist selten gegeben, beinahe minütlich stehen neue Möglichkeiten und Wege auch im Kleinen offen.
Arbeitsalltag und Freizeit verwachsen immer mehr, der Arbeitnehmer checkt auch am Wochenende seine dienstlichen Emails, das Firmenhandy ist eingeschaltet. Der Leistungsdruck wächst, die Geschwindigkeit in der Arbeitswelt steigt – bedingt durch immer schnellere maschinelle Prozesse. Der Mensch ist in seiner Leistungsfähigkeit dagegen auf natürliche Weise begrenzt. Diese Faktoren können zu Dauerstress beim einzelnen führen aufgrund der Persönlichkeitsstruktur und der Disposition.
Sind bestimmte Zielgruppen besonders anfällig für Burnout?
Meiner Meinung nach sind vom Burnout alle Altersgruppen, alle Branchen und Berufe sowie alle sozialen Schichten betroffen. Und ich möchte einmal ganz deutlich betonen, dass auch die Person, die daheim die Familie managt betroffen sein kann. Burnout ist kein Phänomen, das ausschließlich die Managementebene eines Konzerns betrifft.
Tatsächlich ist es so, dass in den lehrenden, sozialen und helfenden Berufen besonders häufig Burnout auftritt
- entweder weil die Personengruppen eher auf die Überlastung achten und es deshalb wohlmöglich schneller zu einer entsprechenden Diagnose kommt – während andere Personengruppen eher aufgrund einer evtl. perfektionistischen Veranlagung dazu neigen, die Symptome herunterzuspielen
- oder weil in diesen Gruppen auffallend oft auch das sogenannte „Helfersyndrom“ zu verzeichnen ist, welches u. a. dadurch gekennzeichnet ist, dass Betroffene permanent helfen wollen, sich praktisch über ihre helfende Leistung definieren und die eigenen Bedürfnisse – auch nach Erholung – zurückstellen. Auch das Alter kann Einfluss auf die „Burnout-Anfälligkeit“ haben. Dazu im Folgenden mehr.
Was sind die Hauptursachen für ein Burnout?
Aus meiner Sicht führt die Kombination verschiedener Faktoren zum Burnout. Persönlichkeit einerseits, Umfeld andererseits haben entscheidenden Einfluss auf das Entstehen einer umfassenden Erschöpfung. Ich selbst ziehe mittlerweile übrigens den Begriff der „(emotionalen) Erschöpfung“ dem des Begriffs „Burnout“ vor. „Burnout“ mutiert in der Bevölkerung von einem Modewort zu einem Unwort.
„Stress entsteht im Gehirn“ – dieser Umstand ist beim Entstehen von Burnout zentral. Die betroffene Person leidet unter der wahrgenommenen Diskrepanz zwischen erdachtem Ideal (eigene Erwartungshaltung) und der Wirklichkeit, welche ja auch wiederum durch eine sehr eigene und persönliche Wahrnehmung entsteht. Der eigene Wunsch nach wie auch immer gestalteter Perfektion spielt eine beachtliche Rolle.
Das Umfeld, der Arbeitsplatz, tut sein Übriges dazu: unklare und/oder permanent wechselnde Strukturen und Zuständigkeiten, eine Atmosphäre der Nicht-Wertschätzung und Nicht-Achtung, Leistungsdruck, fehlende Zielvereinbarungen, permanente Fremdbestimmung mit wenig Möglichkeit zum eigenverantwortlichen Arbeiten lassen den Druck steigen.
Welche Präventionsmaßnahmen innerhalb von Unternehmen sind am wirkungsvollsten?
Prävention ist am nachhaltigsten, wenn sowohl die einzelne Person motiviert und gewillt ist, an sich zu arbeiten und für die persönliche Gesundheit auf individuellem Wege zu sorgen, als auch wenn das Unternehmen seine Rolle und Aufgabe in der Prävention erkennt und diese Verantwortung übernimmt.
Hier gilt es, instrumentelle und organisatorische Maßnahmen zu ergreifen, um die Arbeitsplatzsituation zu optimieren auch im Sinne eines Wohlfühlens im Unternehmen. Darüber hinaus ist es unumgänglich, dass die Geschäftsleitung sich ihrer Vorbildfunktion hier im Besonderen bewusst ist. Burnout-Prävention ist Chef:innen-Sache. Die besten Maßnahmen sind nutzlos, wenn in der Managementetage eine wenig wertschätzende und wenig gesundheitsbewusste Haltung gelebt wird.
Die beschriebene Kombination aus Individualmaßnahmen und unternehmensübergreifenden Maßnahmen kann in Verbindung mit einer geduldigen Strategie der kleinen Schritte kontinuierlich und nachhaltig Veränderungsprozesse anstoßen, welche dafür sorgen, dass Burnout im Unternehmen an Bedeutung verliert.
Und ganz klar: Ein Gesundheitstag einmal im Jahr bringt gar nicht, wenn an den verbleibenden 364 Tagen Leistung, Effizienz und Optimierung fokussiert werden.
Müssen Präventionsmaßnahmen auf jedes Unternehmen zugeschnitten sein oder gibt es bestimmte Maßnahmen, die für jede Art von Unternehmen sinnvoll sind?
Ich lehne es ab, Standard-Programme aus der Schublade zu ziehen. Es muss immer die individuelle Situation vor Ort berücksichtigt werden. Nur wenn alle Prozesse des Unternehmens und die Arbeitsteams als solche Beachtung finden, kann nachhaltig die Arbeitsbewältigungsfähigkeit der Einzelnen und damit die Gesundheit des Unternehmens als Ganzes aufrecht erhalten werden. Dies sollte immer das Ziel eines Unternehmens sein.
Sowohl das Aktivwerden des Individuums als auch das der Arbeitsplatzgemeinschaft ist gefragt. Die einzelne Person muss über individuelle Maßnahmen die eigene Gesundheit stabilisieren. Das Unternehmen als Ganzes trägt Sorge für die Arbeitsplatzgemeinschaft und die Arbeitsorganisation.
Sehr wichtige Aspekte im Rahmen der Arbeitsplatzgemeinschaft sind Themen wie
- Verhaltenskodex
- Wertschätzung
- Achtsamkeit
- soziale Kompetenz
Hier gilt es wie gesagt, individuell zu schauen, welcher Bedarf tatsächlich vor Ort vorhanden ist. Das Rad muss nicht neu erfunden werden. Oberstes Gebot beim betrieblichen Gesundheitsmanagement ist und bleibt die Motivation der Geschäftsleitung und des Managements. Maßnahmen, die nur in einzelnen Abteilungen umgesetzt werden oder von einzelnen Mitarbeiter:innen helfen nicht der Gesamtgesundheit des Unternehmens.
Warum sollte jedes Unternehmen motiviert sein, gesundheitsfördernde Maßnahmen umzusetzen?
Alle Unternehmen sollten hochgradig motiviert sein, gesundheitsfördernde Maßnahmen einzuführen, um langfristig eine nachhaltig gesundheitsfördernde Atmosphäre zu schaffen. Und machen wir uns nichts vor: Eine Unternehmenshaltung, die der Gesundheit der Mitarbeitenden zugewandt ist, kann in Zeiten des Fachkräftemangels ein Wettbewerbsvorteil sein.
Selbstverständlich kosten derartige Maßnahmen Zeit und Geld, dennoch ist diese Investition rein betriebswirtschaftlich betrachtet günstig. Denn die Kosten für einen krankgeschriebenen Mitarbeiter sind um ein Vielfaches höher. Fällt ein Mitarbeiter aufgrund von Krankheit aus, so leidet das Unternehmen nicht nur an der fehlenden reinen Arbeitskraft.
Vielmehr geht wohlmöglich für diese Zeit Know-How und Erfahrung verloren, die so genannte „sticky information“, sprich Informationen, die nicht dokumentiert sind. Eine Vielzahl an Studien belegt mittlerweile, dass die betriebliche Gesundheitsförderung nicht nur positive Gesundheitsaspekte bewirkt, sondern dass die Maßnahmen auch positive betriebswirtschaftliche Effekte nach sich ziehen.
Last but not least sollte man die demografische Entwicklung nicht aus den Augen verlieren, wenn man sich mit der Thematik auseinander setzt. Je älter die Mitarbeitenden werden, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass die Vulnerabilität im Allgemeinen und die Stressempfindlichkeit im Besonderen steigt. Geschwindigkeit ist etwas, mit dem der alternde Mensch aufgrund des sinkenden Reaktionsvermögens im Allgemeinen seine Probleme hat.
Steigender Leistungsdruck, immer stärkere Informationsflut und die Forderung nach schnellerem Arbeitsoutput sind also Themen die wohlmöglich ältere Mitarbeitende stärker betreffen als jüngere. Und da die Bevölkerung stark altert, ist es insbesondere für ein Unternehmen wichtig, sich dem betrieblichen Gesundheitsmanagement konsequent zuzuwenden.
Wenn du dich für das Thema Burnout und Erschöpfung interessierst, dann sind wahrscheinlich auch die folgenden Artikel spannend für dich: